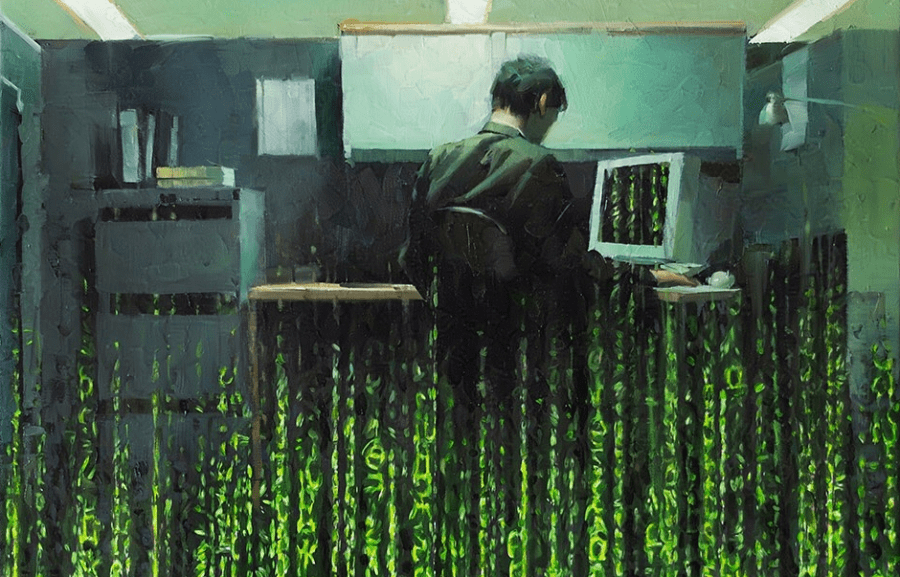Vor einem Monat war ich wieder mal rasier-unlustig und so nach 4 oder 5 Tagen haben meine Töchter gemeint, dass das sicher cool aussehen würde, so Papa mit Bart. Hey, ich hatte in meinem Leben noch nie einen Bart. Also dachte ich No-Shave-November ist mein Ding und habe meine sekundären Geschlechtsmerkmale wild wuchern lassen. Im Militär wird man vom täglichen Rasieren dispensiert, wenn der Bart mindestens drei Wochen alt ist und auch nach Bart aussieht. Also habe ich mir das Ziel drei Wochen gesteckt. Nach einer Woche fing der Juckreiz an und mir wurde wieder klar, warum ich nie im Leben einen Bart stehen liess. Die Barbologen in meinem Freundeskreis empfahlen abenteuerliche Bartöle, von Jojoba- über Rizinus- bis Mandelöl. Ich habe auf verkleistertes Gestrüpp verzichtet und mannhaft das Jucken erduldet. Wenn niemand hinsah, habe ich meinen Kiefer gekratzt, als stünde er in Flammen. Schon nach zwei Wochen kannte mich mein Handy nicht mehr. Gesichtserkennung? Nicht mit der Matte in der Visage. Ausserdem fühlte es sich nach dem morgendlichen Duschen seltsam an. Als hätte man einen nassen Waschlappen im Gesicht. Unterkiefer trockenrubbeln gehörte von nun an zur täglichen Routine, genauso wie Barthaare kämmen. So Gesichtshaare haben nur wenige Vorteile: Sie kaschieren ein fliehendes Kinn, geben warm im Winter und man kann sich im Gesicht kratzen und sieht dabei aus wie ein Denker und nicht wie ein Depp mit Krätze.

Bart abschlagen in 7 Etappen: Rauschebart, Abwart Zwicky, Fernfahrer, Metalhead, Zappa, Pornobalken, Chaplin und nature.
Nach drei Wochen überwiegen für mich die Nachteile: Mein Gesicht fühlt sich an, wie … haben Sie mal einen Rauhaardackel gestreichelt? Genau SO! Die Komplimente, die ich bekommen habe, machen das Gefühl nicht wett, dass ich beim Einschlafen glaube, ich hätte eine Filzmatte zwischen Gesicht und Kissen. Wussten Sie, dass man wegen dem Schnauz beim Trinken immer so einen nassen Patch unter der Nase hat? Kapillarkräfte. Einfach nur eklig. Eine Arbeitskollegin hat neulich ihren bärtigen Partner geheiratet. Sie waren mehr als fünf Jahre zusammen und sie hat ihn noch nie ohne Bart gesehen. Vielleicht hat er gar kein Kinn? Sie wird es vielleicht nie erfahren. Wieauchimmer – meine Töchter haben mich beschwatzt, meinen Rauschebart trotzdem bis nach dem Samichlaustag wachsen zu lassen. Ich bin bekanntermassen affektlabil und habe eingewilligt. Meine Flokati-Front hat in der vierten Woche eine erste Trimmung erhalten, der Hals wurde wieder freigeschnitten. Ich bekomme Komplimente – nicht nur von Männern. Trotzdem: Für mich überwiegen die Nachteile: Wenn zum Beispiel der beschnauzte Mann sich schneuzt, weiss er danach nie, ob da noch Schleim oder Popel in der Rotzbremse hängen. Auch Reste von Mahlzeiten halten sich gerne an Gesichtshaaren fest. Deshalb auch der Ausdruck «Flavor Saver», den meine ältere Tochter meinem Bart gegeben hat. Immerhin: Andere Körperteile, die einen eigenen Namen bekommen, erhalten kaum so viel Tageslicht. Auch olfaktorisch gibt so ein Bart nichts her. Du riechst ständig Haare. Steht auch nirgends in der Gebrauchsanweisung. Sehr irritierend. Trotz der Komplimente «ohne Bart eine solide Sieben, mit Bart schon fast eine Acht» habe ich vor ein paar Tagen Klinge und Kamera gezückt. In mehreren Etappen – Salamitaktik an der Fassade – bin ich zu Werke gegangen. Erst den Jesus, dann alle Wangenhaare weg: Rap-Industrie-Standard. Alles hinter dem Kinn rasieren und nur vorne den Schiissideckel übriglassen – der sogenannte Abwart-Zwicky-Look. Dann unten am Schnauz die Brücke zum Kinn durchtrennen, fertig ist der Hulk Hogan. Mit ein paar gekonnten Schnitten wurde sofort ein Robin Hood daraus. Weg mit dem Ziegenbärtchen, übrig bleibt ein breiter Schnauz und die Unterlippen-Mumu: Frank Zappa. Schnipp – Reduktion auf Oberlippe: Der Pornobalken, auch Schweizer-Ordonnanz-Schnauz genannt. Einen konnte ich mir nicht verkneifen. Den Charlie Chaplin, benannt nach seinem zweitbekanntesten Träger. Ein zweitletztes Foto, ein kurzer Schnitt und dann wars vorbei, mein 32-Tage-Bart-Abenteuer. Uff!
Ab jetzt wieder full Brazilian im Gesicht und ja, ich weiss jetzt, wo der Most geholt wird.
(Tagblatt der Stadt Zürich, 17.12.2025)